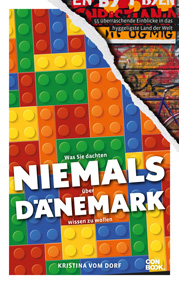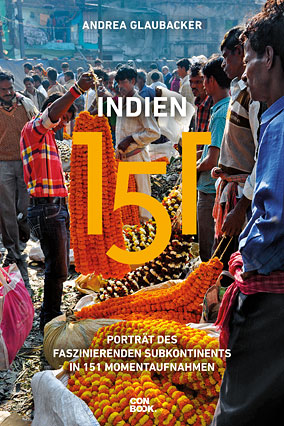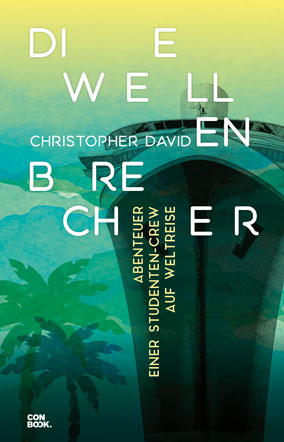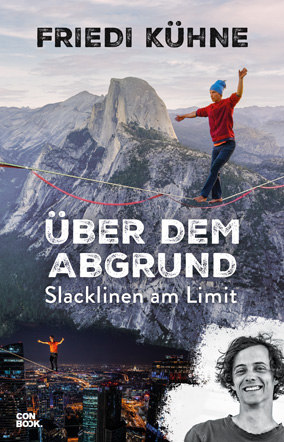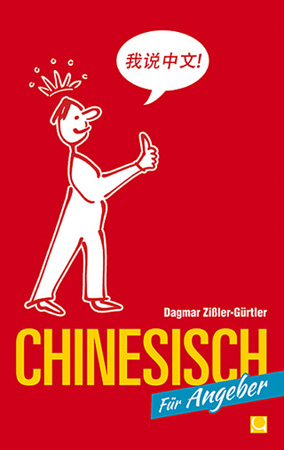Alles kann warten
Ein Roadtrip

Januar 2016 (1. Auflage)
Taschenbuch mit Einbandklappen, 320 Seiten
ISBN: 978-3-95889-109-8
€ 9,95 [D] • € 10,30 [A] • SFr. 14,90* [CH]
Von diesem Buch ist eine kostenlose EPUB-Version erhältlich. Bei Interesse schreiben Sie an ebookinside@conbook.de.
Roman
Paul ist Anfang 40 und Lehrer. Ein Haus, einen Garten, eine Familie hat er auch. Doch irgendwo zwischen Beruf und Alltag hat er sich selbst verloren.
Als seine Mutter ihm klarmacht, dass nicht mehr viel Zeit bleiben wird, um endlich den Streit mit seinem Vater beizulegen, ergreift ihn schlagartig das Gefühl etwas ändern zu müssen.
Zusammen mit seinen Kumpels aus Kindheitstagen Robert und Immel macht er sich auf den Weg in die alte Heimat. Ihr eigentliches Ziel verlieren die drei Freunde aber schnell aus den Augen, denn nicht nur Paul stellt sich die Frage, ob er eigentlich das Leben lebt, das er immer leben wollte. Robert, der Arzt und egoistische Workaholic, vernachlässigt alle, die ihm nahestehen. Und Immel, der Lebenskünstler, verweigert sich jeder Verpflichtung und lebt noch immer wie ein Teenager.
Alle drei stürzen sich in ein Abenteuer nach dem nächsten, lassen ihre gemeinsame Leidenschaft für Popmusik und Alltagsweisheiten hochleben und genießen es in vollen Zügen, sich endlich mal wieder frei zu fühlen.
Doch am Ende der Reise muss sich jeder der drei Männer die Frage stellen: Kann man ein Leben, das man einmal aus der Hand gegeben hat, wieder zurückholen?
E-Book inside: Dieses Buch enthält einen Code zum kostenlosen Download der E-Book-Version.
Stimmen zum Buch
»Ganz nebenbei werden große Themen wie Liebe, Älterwerden und Midlifecrisis verhandelt.«
(REGIO Magazin)
(Jürgen Kudlacek-Pertl, maennerformat.de)
»Lustiger und emotionaler Roadtrip, der in einem amüsanten und berührenden Buch erzählt wird.«
(Niklas Leseblog)
(Freiburg aktuell)
»Respekt. Der Autor weiß, was es heißt, die Post-Adoleszenz in die Verlängerung zu retten.«
(In münchen)
(Chilli – das freiburger stadtmagazin)
»In ›Alles kann warten‹ lässt der Autor dialogische Funken sprühen.«
(Zeitung am Sonntag)
»Zwischen Satire, Bildungsroman und Kolportage gelagert und auf jeden Fall unterhaltsam.«
(Badische Zeitung)
»Dieser Marc Hofmann schreibt manchmal sanft, manchmal rau, manchmal nimmt er richtig Fahrt auf, manchmal bremst er hinein in die Lakonie. Ein Roman wie ein Bruce-Springsteen-Song!«
(Hannes Ringlstetter, »Schinderhannes«)
»Ein Männertrip quer durch die Republik, mit albern-coolen Wortgeplänkeln voller Film- und Liedzitaten und der Sinnfrage, wie es weitergehen soll.«
(ekz.bibliotheksservice)
(AHOI – Magazin für Musik und Kultur)
Leseprobe
6
Auf dem Wohnzimmertisch hat H. D. einige Linien mit weißem Pulver hergerichtet.
»Gleich kommt noch Besuch.«
»Ui, schön«, ruft Immel und reibt sich die Hände, als er sieht, was H. D. da vorbereitet hat. Mir wird etwas mulmig. Koks. Ich erinnere mich dunkel an ein oder zwei Versuche während des Zivildienstes oder im ersten Semester, auf jeden Fall vor Gretas Geburt. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich das letzte Mal gekifft habe – von den zwei Zügen vorhin im Auto abgesehen. Und jetzt das!
Immel blickt mich fröhlich an.
»Na, Herr Studienrat, wie steht‘s?«
»Ich weiß nicht, Immel.«
»Na komm, Alex verwirklicht sich selbst, die Mädchen brauchen dich nicht mehr. Time Waits for No One.«
Mein Zwerchfell prickelt. Dass auf dieser Fahrt, allein schon durch Immels Anwesenheit, nicht alles planbar sein würde, war eigentlich klar. Ich merke aber gerade, wie sehr mich das freut. Ich denke kurz an meine drei Frauen zu Hause. Alex sitzt sicher gerade am Computer und sieht sich die Aufnahmen des Tages an. Was hatte sie heute noch mal für einen Auftrag? Die Fotos für die Versicherung? Oder war das letzte Woche? Keine Ahnung. Anouk macht sicher Hausaufgaben oder chattet oder beides und Greta ist vielleicht bei Max.
Max, der den Mund beim Reden nicht richtig aufbekommt vor lauter Coolness, und der einen fürchterlichen Musikgeschmack hat.
Ich denke an den letzten Krach mit Alex. Worum ging es noch mal? Ich weiß es nicht mehr. Irgendetwas Bescheuertes. Einkaufen, Haushalt.
Das gibt meinem Über-Ich den Rest und sorgt für seine Kapitulation. Das habe ich mir jetzt mal verdient. Ich beschließe, dieser Nacht einfach ihren Lauf zu lassen. Ich setze mich auf den Boden vor dem Wohnzimmertisch.
Wir konsumieren die illegale Substanz.
Dass es so schnell gehen würde, hätte ich nicht gedacht. Irgendetwas in meinem Kopf leuchtet. Ich grinse Immel an. Mein Herz rast etwas zu schnell, aber sonst geht es mir so gut wie lange nicht.
Immel beginnt irgendetwas von Wurmlöchern und der Stringtheorie zu faseln. H. D. redet über Wurstherstellung und ich höre den beiden fasziniert zu, wie sie eine hitzige Debatte simulieren, in Wirklichkeit aber nicht nur komplett aneinander vorbei, sondern über zwei völlig unterschiedliche Themen sprechen.
Immer wieder kommen jetzt Menschen zur Tür herein, manche stellen sich mir vor. Es wird laut. Irgendjemand hat Musik aufgelegt. Japanese Easy Listening, Krautrockklänge und die unvermeidlichen Dubstep-Rhythmen schweben an mir vorbei. Ich schlendere durchs Haus, schaue mir die Menschen an, wie sie feiern, sich treiben lassen, tanzen. Ich bleibe immer mal wieder stehen, um entweder etwas zu beobachten oder einfach ins Nichts zu starren. Es kommen wenig zusammenhängende Gedanken zustande, aber ich bin trotzdem oder gerade deshalb aus irgendeinem Grund sehr zufrieden. Glücklich gar. Wann habe ich mich das letzte Mal einfach so über etwas gefreut? Am Leben zu sein. Nichts zu müssen. Etwas Unerwartetes zu erleben.
Ich höre, wie Immel sich hektisch mit einer Mexikanerin in einer mir unbekannten Sprache unterhält.
»Das ist der Wahnsinn«, schreit er mir ins Ohr. »Ich spreche gar kein Spanisch und sie kein Deutsch und kaum Englisch, aber wir reden jetzt schon seit einer halben Stunde. Ich glaube, sie arbeitet für ein Drogenkartell oder macht einen Sprachkurs, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht heiraten wir.«
Robert wankt uns entgegen. Er legt die Hände über Immels und meine Schultern.
»Ich bin verliebt und sexualisiert gleichermaßen. Diese Asia ist die tollste Frau, die mir je begegnet ist.«
»Dr. Robert«, sagt Immel. »The sky is the limit.«
»Excuse me, while I kiss the sky«, sagt Robert und verschwindet wieder.
Plötzlich finde ich mich in einer Unterhaltung mit einem Typen wieder, der mir von seinem Witch-House-Projekt erzählt.
»Ich will Musik herstellen, die Menschen Angst macht«, sagt er.
Mit Angst kenne ich mich aus, denke ich. Die hat mich meine ganze Kindheit begleitet. Und ich weiß nicht mehr, was schlimmer war als Kind: ganz alleine im Haus zu sein oder alleine mit meinem Vater im Haus zu sein.
Plötzlich kommen etwa ein Dutzend schwarz gekleideter Menschen herein, Männer und Frauen. Die Männer tragen Staubmäntel, Cowboystiefel und Hüte, die Frauen sehen aus wie Sharon Stone in Schneller als der Tod.
Sie stellen sich in zwei Reihen auf. Aus den Boxen kommt eine Liveversion von Johnny Cashs Folsom Prison Blues und sie fangen an zu tanzen. Es sieht aus wie eine Mischung aus Squaredance und diesem Wave-Tanzstil aus den Achtzigern, bei dem die Tänzer wie in Zeitlupe mit weit ausladenden Schritten imaginäre Geldstücke vom Boden aufheben. Es ist mit Abstand das Coolste, was ich je gesehen habe. Ich will sofort Mitglied dieser Bewegung werden. Ich muss die unbedingt fragen, ob man da mitmachen kann. Doch zwei Sekunden später habe ich diesen Vorsatz bereits vergessen und stakse auf wackeligen Beinen nach draußen.
Robert steht nackt am Rand des Pools. Er ruft: »Ich bin ein goldener Gott« und hüpft ins Wasser, wo eine ebenfalls nackte Asia schon auf ihn wartet.
Ich suche Immel. Er ist weg. Immel ist immer weg, wenn man ihn braucht.
Ich kann nicht sagen, wie es dazu kommt, aber mit einem Mal sitze ich mit dem Boss der Cowboys mit Whisky in der Hand auf der Hollywoodschaukel. Er stellt sich mir als Steve vor, aber seinem sächsischen Akzent nach zu urteilen, heißt er in Wirklichkeit wahrscheinlich eher Stefan.
Er erzählt mir von seiner Faszination für den Wilden Westen.
»Wenn man in der DDR aufgewachsen ist und einigermaßen bei Trost war, gab es nur eins, wovon man träumte. Und das waren sicher nicht Russland oder diese albernen sozialistischen Indianerfilme mit Gojko Mitic. Obwohl man ja selbst über die froh war. Es gab ja nichts anderes.«
»Und, hast du diese Bildungslücke mittlerweile geschlossen?«, frage ich. »Was ist dein Lieblingswestern?«
Es war Roberts John-Wayne-Manie, die der Auslöser dafür war, dass wir uns während unseres Zivildienstes sicher mehr als 40 Westernklassiker angesehen haben. Wir konnten eine ganze Weile überhaupt nichts anderes mehr schauen. Immel hat sich nach drei oder vier Filmen mit den Worten »Ihr habt sie doch nicht mehr alle« ausgeklinkt, aber ich muss sagen, dass ich mittlerweile mit einigem Stolz auf diese Leistung blicke.
»Ganz oben steht für mich Rio Bravo, den hab ich sicher zehnmal gesehen«, sagt Steve.
Ich lächle in die Nacht.
»Erinnerst du dich an die Szene, wo die drei eingeschlossen sind, alles ist hoffnungslos und dann beginnen Dean Martin und Ricky Nelson dieses Lied zu singen?«
Ich nicke. »Wen das kalt lässt, mit dem stimmt etwas nicht«, sage ich in der Hoffnung, dass ihn das freut.
»Genau!«, ruft er. »Ich würde sogar sagen: Eine Frau, die diese Szene nicht albern findet, darf man nie mehr ziehen lassen. So habe ich es gemacht.«
Interessant, denke ich. Ich habe mit Alex nie einen Western angeschaut. Das hätte ich vielleicht mal tun sollen.
»Mein Lieblingswestern ist Red River«, sage ich.
Steve zieht die Luft durch die Zähne ein.
»Ganz groß«, bestätigt er. »Shakespeare. Da gehts ums Ganze.«
Wir sehen versonnen dem Treiben im Pool zu.
Ich denke darüber nach, wie das Verhältnis zwischen John Wayne und Montgomery Clift in Red River dem zwischen mir und meinem Vater ähnelt. Ich glaube, mein Vater hat das pädagogische Konzept, dass die Kinder ihre Eltern, Lehrer oder Mentoren überflügeln sollten und ein Mentor nur dann gut sei, wenn das gelinge, nie so ganz verstanden. Ich glaube, er wollte von mir enttäuscht sein. Wenn mir etwas misslang, hat es ihn bestätigt. Wenn nicht, hat er es ignoriert.
In Red River fängt John Wayne an, seinen Ziehsohn als Konkurrenten zu betrachten, dessen Erfolg er um jeden Preis verhindern möchte. Ich denke an meinen Vater.
Ich war elf oder zwölf. Wir hatten mit 4 : 1 gegen den Nachbarort gewonnen, ich hatte alle vier Tore geschossen. Meiner Mutter habe ich voller Stolz davon erzählt. Sie hat sich gefreut und hat mich an der Hand genommen, sodass ich es meinem Vater erzählen konnte. Er war hinter dem Haus und reparierte Hasenställe. Ich sagte es ihm. Er sah nicht mal auf.
7
»Jungs, was wollt ihr trinken?«
Eine Frau steckt ihren Kopf zwischen uns. Ihre Hände hat sie auf unsere Schultern gelegt.
»Ich bin die Gabi.« Sie streckt mir ihre Hand hin.
Gabi sieht aus wie Marianne Sägebrecht in einer Nebenrolle eines Films, der im Working-Class-Milieu von Minnesota spielt.
»Seid ihr bereit?«, fragt sie.
Steve nickt und fordert mich mit einer Kopfbewegung auf, wohin auch immer mitzukommen. Wir gehen in die Küche.
Dort sitzt bereits allerhand Volk um einen runden Tisch. Und da ist auch Immel wieder.
»Paul!«
»Immel, auch du mein Sohn?«, sage ich, ohne zu wissen, worum es hier geht.
»Immer.«
Auf dem klebrigen Tisch stehen Bierflaschen und eine Flasche Wodka sowie etliche Schnapsgläser.
»Wir spielen Wahrheit oder Pflicht in der Stripversion«, informiert Gabi Immel und mich. »Seid ihr dabei?«
Wir scheinen die Einzigen zu sein, die in dieses Spiel eingewiesen werden müssen.
»Fuck«, presst Immel hervor und er klingt dabei wie Ben Kingsley in den Sopranos als er merkt, dass Christopher Moltisanti im selben Flugzeug sitzt wie er.
»Das kann doch nicht wahr sein jetzt«, stöhne ich und schaue zu ihm. Er strahlt mich an.
»Wir sind dabei!«, höre ich Immel rufen.
Am Tisch sitzen noch: Steve, Gabi, Gabis kopftuchtragender Bikerfreund Charly, Sven, ein weiteres Mitglied der Cowboytanzgruppe, Harald, ein großer, dünner Typ aus Hoyerswerda, H. D., Claudia und Svetlana, zwei der Sharon Stones, wobei Svetlana deutlich zu gut aussieht für diese Art von Abendunterhaltung.
Die meisten sind schon deutlich übersteuert. Ein Setting wie in einem Pornofilm, denke ich besorgt.
»Ein Setting wie in einem Pornofilm«, flüstert Immel mir ins Ohr und reibt sich grinsend die Hände.
Harald und Steve setzen sich mit Bier und Whisky an die Bar und schauen zu.
»Die Regel ist die«, erklärt Gabi, »jeder bringt eine Anekdote aus seinem Leben oder eine Tatsache über sich, irgendetwas Peinliches oder Wahnsinniges, und die anderen müssen entscheiden, ob wahr oder erfunden. Wenn die Mehrheit richtig liegt, muss der, der dran ist, ein Kleidungsstück ablegen.«
»Was ist mit dem Wodka?«, frage ich.
»Getrunken wird immer«, antwortet Gabi, und Charly, der Biker, lacht heiser.
»So, neuer Süßer«, sie meint mich. »Du beginnst!«
Kurz werde ich panisch, weil mir nichts einfällt. Doch dann entsinne ich mich einer Begebenheit, von der ich noch nie jemandem erzählt habe. Jetzt scheint ein guter Zeitpunkt dafür.
»Also gut. Ich bin mit zwölf an einem See, an dem ich mit meinen Eltern Urlaub gemacht habe, an eine Oben-ohne-Frau herangetaucht, habe ihr mit beiden Händen und mit voller Absicht an die Brust gefasst, und bin wieder weggetaucht.«
Großes Gejohle allenthalben. Die meisten stimmen für Richtig. Ich trinke einen Wodka und ziehe einen Schuh aus.
»Der Freund des Busenmanns ist dran«, sagt Claudia.
»Ich habe einem völlig betrunkenen Bekannten einen Kühlschrank auf den Rücken tätowiert«, sagt Immel.
Da die Mehrheit auf Falsch tippt, darf Immel alles anbehalten. Ich starre ihn amüsiert an. »Das musst du mal erzählen.«
»Ein andermal.«
»Ich hatte schon mal Sex mit einem Tier«, behauptet Charly der Biker.
Die Mehrheit tippt auf Falsch, Charly legt sein Kopftuch ab und entblößt eine tätowierte Glatze.
»Ich habe nie Unterwäsche an«, gesteht Claudia. »Auch jetzt nicht.« Alle tippen auf Richtig. Sie darf alles anbehalten. Oh je. Der Abend nimmt eine mehr als bedenkliche Wendung.
»Ich habe schon mal jemandem einen Finger abgeschnitten«, sagt Sven, der Cowboy. Wir tippen auf Falsch und zum Glück muss er etwas ausziehen.
H. D. sagt: »Ich habe in meiner Zeit beim Plattenlabel mit mindestens drei euch allen bekannten Popsängerinnen geschlafen.«
Natürlich glauben wir ihm und auch er zieht sein Poloshirt aus, sagt aber, trotz heftiger Proteste, nicht, wer sie waren.
Eineinhalb Stunden später, mittlerweile sehen uns eine ganze Reihe Leute zu, sitzen wir mächtig derangiert am Tisch. Ich trage nur noch meine Jeans, Immel noch seine Unterhose. Die schöne Svetlana stellt sich als hochgradig hartgesotten heraus. Ihr osteuropäischer Akzent tut sein Übriges. Die ersten paar Male haben wir sie unterschätzt, mittlerweile gibt es wenig, was wir ihr nicht zutrauen würden. Wenn sie uns als nächstes beichtet, ihre Eltern erstochen und dabei Karel Gott gehört zu haben, oder dass sie ein Kind vom Don der Russenmafia hat: Die meisten würden auf Richtig tippen. Das größte Problem dabei ist, dass alle am Tisch und drumherum voll sind wie die Eimer. Zu allem Überfluss haben wir bei Svetlana immerhin so oft richtig gelegen, dass sie für die Verfassung, in der sich die Männer im Saal befinden, deutlich zu wenig anhat. Dass sie jetzt noch an der Reihe ist, macht es nicht besser.
»Ich stehe auf Sex mit zwei Männern«, sagt sie trocken.
Immel spuckt mir sein Bier über den nackten Oberkörper. Es wird still im Raum.
Ich will die Antwort nicht hören und gehe aufs Klo. Ich setze mich hin und starre die Tür an. Alles dreht sich. Vor der Tür wird gejohlt. Ich muss grinsen. Was für ein surrealer, unerwarteter Spaß, dieser ganze Trip. Wie toll das Leben sein kann, wenn man es lässt.
Als ich zurückkomme, hat sich die Runde aufgelöst. Ich muss auf dem Klo eingeschlafen sein. Einige Teilnehmer haben sich wieder etwas angezogen, die anderen bleiben, wie sie waren.
Irgendjemand hat die Wilco-Liveplatte aufgelegt. I was saved by rock ’n’ roll, singt Jeff Tweedy. Wie recht er hat!
Ich wanke aus der Küche und laufe an einem Raum vorbei, in dem ein paar Leute die Wilhelm-Tell-Szene aus Naked Lunch nachspielen. Glücklicherweise verwenden sie Äpfel als Wurfgeschosse, während auf ihren Köpfen Stofftiere sitzen.
Im Wohnzimmer sehe ich, wie der Witch-House-Typ mit einem schwarzen, halbnackten Mann mit Indianerschmuck auf dem Kopf Schach spielt.
Was mache ich hier eigentlich? Ach ja, ich bin auf dem Weg in den Schwarzwald, um mit meinem Vater zu reden.
Schlagartig bin ich wieder deutlich nüchterner. Ich trinke drei Gläser Wasser in der Küche und suche einen Platz zum Schlafen. Die dritte Tür, die ich öffne, führt zu einem Zimmer, dessen Fußboden voller Kissen und Polster ist. Dort lege ich mich hinein. In meinem Kopf loopt sich Jeff Tweedys endlos wiederholtes Nothin‘ aus Misunderstood fest und das Wort hallt für den Rest der Nacht durch meine Träume.
8
Ich wache auf und stelle erfreut fest, dass es mir erstaunlich gut geht. Ich laufe in die Küche und mache mir einen Kaffee. Im Wohnzimmer und im Garten liegen Menschen herum.
Mit der Tasse in der Hand begebe ich mich auf die Suche nach meinen beiden Reisebegleitern. Ich öffne eine Tür. In dem Zimmer liegen H. D., Asia und Robert, alle drei nackt.
Robert wird wach und sieht mich irritiert an. Blinzelnd schaut er auf die anderen beiden, dann springt er plötzlich auf und stürmt an mir vorbei ins Bad.
Fünf Minuten später sitzen wir im Garten und halten uns an unseren Kaffeetassen fest. Ich versuche zu rauchen. Es geht schon wieder. Alles klar.
»Sag jetzt nichts«, sagt Robert.
Ich hebe grinsend die Hände.
»Wo ist Immel?«, fragt er.
»Das ist eine gute Frage. Irgendwann war er verschwunden.«
Wir machen uns auf die Suche. Ohne Erfolg. Langsam beginnt das Haus zu rumoren. Jemand legt Rome von Danger Mouse auf. Ich liebe diese Platte. Ich setze mich aufs Sofa, lege den Kopf in den Nacken und höre zu, während um mich herum verkaterte Menschen stöhnend zu sich kommen und krächzend nach Kaffee verlangen.
Zwei Dinge haben mir in meiner Jugend das Leben gerettet. Und diese Formulierung ist vielleicht nicht einmal übertrieben.
Das eine waren Bücher, vor allem solche, die man gemeinhin als Fantasy-Literatur bezeichnet. Ausgelöst durch Der Herr der Ringe, das ich mit zwölf zum ersten Mal las, folgten in den nächsten Jahren unzählige wie im Fieberwahn verschlungene Fantasy-Epen von Stephen King, C. S. Lewis, Lovecraft, später Tad Williams oder Robert Jordan. Und damit verbunden war dann auch das Schreiben. Vor allem das Schreiben war eine Fluchtmöglichkeit, wenn es zu schlimm wurde.
Das andere war die Musik. I was saved by rock ’n’ roll. Es ging los mit Kassetten von den Beatles oder Queen, Radiomitschnitten, die manchmal erst mitten im Lied begannen und am Ende immer noch die Stimme des Moderators, der ins Fade-out quatschte, enthielten.
Das Schreiben hörte auf. Aber die Leidenschaft für Musik und Geschichten blieb. Die Bücher mussten weniger umfangreich werden, weil die Zeit nicht mehr reichte, aber die Musik fand immer einen Weg durch den Alltag.
Ich kaufe sogar noch regelmäßig Musik. Und zwar nicht nur die aus meiner Jugend wie die meisten Männer meines Alters, die nur noch Nostalgiekäufe tätigen.
Ich mache keinen Sport und keine Kochkurse und gehe für einen Deutschlehrer auch äußerst selten ins Theater. Ich höre keinen Jazz und kaum Klassik. Aber ich gehe nach wie vor in Rockkonzerte. Meistens alleine, manchmal mit Immel. Sonst gibt es in meinem Bekanntenkreis kaum jemanden, der sich damit noch abgibt. Die haben jetzt alle Wunschkinder und gehen abends nicht mehr aus dem Haus. Und wenn doch, dann stecken sie, wie Robert, in der Siebziger- oder Achtziger-Nostalgieschleife fest.
Die Liebe zu einer Frau kann sich verändern, kann wirklich weniger werden. Man kann sich entlieben, was vielleicht das ist, was Alex und mir gerade passiert.
Bei der Musik geht das nicht. Das hat fast etwas Religiöses, Unumstößliches. Und ein tolles Konzert ist das Hochamt. Wenn die Band und das Publikum sich gegenseitig hochschaukeln und alle bereit sind, alles zu geben. Egal in welcher Verfassung man ist, egal in welcher Lebensphase, die Wirkung ist immer die gleiche. Diese unfassbare Euphorie und Lebensfreude, die dich bei einem Konzert von Arcade Fire packt und durch die Nacht schleudert. Dieser in jeder Note und jedem Wort deutlich hörbare Glaube an die spirituelle, heilende und erlösende Kraft eines guten Konzerts.
Andererseits, denke ich, muss man sein Leben immer noch selbst auf die Reihe kriegen, Rock ’n’ Roll hin oder her.
Asia kommt heraus. Sie trägt einen zu großen blauen Kimono mit einem goldenen Drachen darauf und küsst Robert auf den Mund und mich auf die Wange.
»Eier?«, fragt sie.
Vorsichtshalber sagen wir Ja.
Fünf Minuten später kommt sie mit drei Tellern Rührei und gebratenem Speck zurück. Wir strahlen sie dankbar an und fragen sie, ob sie etwas von Immel weiß.
»Der ist mit den Cowboys abgedampft«, erwidert sie.
»Wie abgedampft?«, frage ich.
»Was, die Cowboytypen waren da?« H. D. kommt mit einem Lachsbrötchen in der Hand ins Wohnzimmer. Die Frage wundert mich etwas, denn schließlich hat H. D. die halbe Nacht mit einigen von den Cowboys und Girls dieses bescheuerte Stripspiel gespielt. Aber andererseits wundert die Frage mich auch wieder nicht, wenn man bedenkt, was da alles konsumiert wurde. Auch H. D. trägt einen Kimono, aber offensichtlich ist es der von Asia, denn er ist ihm deutlich zu kurz und deshalb sehen wir sein Gemächt unten herausbaumeln. Er steuert auf Robert zu und küsst ihn auf die Stirn, worauf der schwer ausatmet und in sich zusammensackt.
Ich muss lachen.
»Habt ihr die tanzen gesehen? Super, was?«, fragt H. D.
»Und jetzt?«, frage ich.
»Ich weiß, wo Steve wohnt«, sagt H. D. »Gib mir zehn Minuten. Dann fahren wir da hin.«
9
Die zehn Minuten waren sehr optimistisch kalkuliert, aber jetzt sind wir, Robert, H. D., Asia und ich, unterwegs nach Dresden. Was macht Immel da? Wird er vielleicht von Steve gefangen gehalten und wir müssen ihn auslösen, weil Steve herausbekommen hat, dass Immel reich ist?
Robert und Asia haben es sich hinten bequem gemacht, sie hat den Kopf an seine Schulter gelehnt. Er schaut zum Fenster hinaus auf ein imaginäres Meer.
»Super, dass ihr da wart, gestern«, sagt H. D., der neben mir sitzt. »Hast du Mucke?«
Ich hole meinen Minidisk-Player aus dem Handschuhfach. Da ich mich vor vielen Jahren fatalerweise dafür entschieden habe, die MD dem MP3 vorzuziehen, sitze ich jetzt auf etwa 200 selbst zusammengestellten MDs. So bin ich bislang der einzige Mensch, den ich kenne, der MDs hört. Wenn mein Player irgendwann den Geist aufgibt, wird es mir wie Denzel Washington in The Book of Eli ergehen: Ich werde so einen postapokalyptischen Tante-Emma-Laden aufsuchen müssen – mit einem Typen drin, der aussieht wie Tom Waits. Und dem verkaufe ich dann meine Handschuhe oder meine Seele für einen Ersatz.
Medienelektronisch aufs falsche Pferd zu setzen, das scheint bei uns in der Familie zu liegen. Immerhin eine Gemeinsamkeit zwischen mir und meinem Vater. Der hat seinerzeit auch auf Beta 2000 gesetzt, aber musste vor der kalifornischen Pornoindustrie, die am Siegeszug der qualitativ minderwertigeren VHS-Kassetten schuld war, kapitulieren.
H. D. grinst, als er mich mit dem Gerät hantieren sieht.
»Jaja«, sagte ich. »Mach dich nur lustig. Ich bin das gewohnt.«
»Nie würde ich mich über derartige Absonderlichkeiten lustig machen.« H. D. kichert. »Mir ist nichts Menschliches fremd.«
»Ja, das hab ich gesehen«, sage ich grinsend.
Ich lege meine Smiths-MD ein. Das erste Lied ist zufällig Paint a Vulgar Picture.
At the record company meeting, on their hands – a dead star. And oh, the plans they weave, and oh, the sickening greed, singt Morrissey.
Ich sehe zu H. D. rüber und muss lachen.
»Ahh«, macht der, »lange nicht gehört. Ausgezeichnet.«
»Du bist bei einem Label?«, frage ich ihn.
»Nein, ich war.«
»Wieso jetzt nicht mehr?«
Er winkt ab.
»Zu stressig. War nicht gut fürs Herz, der Job.«
Morrissey, der es wissen muss, singt: Heaven knows I’m miserable now.
»Und du«, fragt H. D., »was hast du mit Musik zu tun?«
Ich überlege, ob ich ihm sagen soll, dass Immel, Robert und ich sogar mal eine Band hatten. Wir waren etwa in der zwölften Klasse. Geprobt haben wir im Keller von Roberts Eltern. Immel hat getrommelt und gesungen, Robert hat Bass und ich Gitarre gespielt. Wir hatten einen einzigen, fürchterlich schlechten Auftritt bei einer Silvesterparty im Gemeindezentrum. Offenbar mangelte es uns allen drei an Ehrgeiz. Sogar Robert. Nach Gretas Geburt habe ich kaum noch Gitarre gespielt. Es war anstrengend genug, mit Baby und schier ohne Geld das Studium zu beenden. Vielleicht fange ich irgendwann mal wieder an.
»Ich höre gern Musik, das ist alles«, antworte ich.
Wir überqueren die Elbe. Das Wasser glitzert im Sonnenlicht.
Nach einem weiteren Lied von The Smiths gebe ich mir einen Ruck und stelle die Frage, die mich seit gestern Nacht nicht mehr loslässt.
»Kannst du das mit eurer Polyamorie mal genauer erklären?«
H. D. lacht.
»Na ja, im Wesentlichen geht es darum, dass man Affären oder sogar längere Beziehungen mit mehr als einem Partner hat und das Ganze mit deren vollem Wissen und Einverständnis.«
Ich überlege kurz.
»Und dazu gehört auch, dass man seine Frau mit einem Fremden teilt, oder wie?«
Ganz so deutlich wollte ich es eigentlich gar nicht formulieren, aber ich wusste nicht, wie ich es anders sagen sollte.
H. D. räuspert sich.
»Na ja, in der reinen Lehre ist das wohl so nicht gedacht. Aber wir experimentieren da hin und wieder ein wenig.« Er lacht.
»Und das funktioniert? Ich meine, eure Beziehung im Großen und Ganzen?«
»Unbedingt. Kann ich nur empfehlen. Probiere es aus!«
Interessant, denke ich. Aber wie um alles in der Welt unterbreitet man seiner Partnerin, dass man einem solchen Konzept gegenüber aufgeschlossen wäre. Alex’ Reaktion kann ich mir lebhaft vorstellen:
Verstehe ich dich richtig, du willst einen One-Night-Stand und ich soll dazu meinen Segen geben, ja?
– Na ja, du könntest ja auch ... ich meine ...
– Und wenn ich das nicht will? Wenn ich gerade genug um die Ohren habe? Jetzt, wo wir gerade mal wieder den Kopf über dem Wasser haben, soll ich mich gleich wieder in ein neues Beziehungs- und Gefühlschaos stürzen? Nein danke, ich verzichte!
– Gut, ich geh dann mal einkaufen, willst du etwas Bestimmtes?
So in etwa würde es ablaufen, jede Wette.
Kurze Zeit später stehen wir vor einem mehrstöckigen Altbau mitten in Dresden, in dem Steve, der Cowboychef wohnt. Wir klingeln, der Öffner summt und wir steigen in den obersten Stock, wo eine Frau, deren Alter schlecht zu schätzen ist, die Tür öffnet.
»Tag, H. D. Hey, Asia. Tolle Party gestern. Ihr beiden wart auch da, oder?«
Ich glaube, in der Frau eine der Sharon Stones von gestern zu erkennen.
»Hi, wir wollen unseren Freund abholen. Übrigens, euer Tanz war der Hammer letzte Nacht.«
»Danke, sagt sie und lächelt nett. »Steve und dein Freund sind schon ganz früh los. Hier liegt ein Brief von ihm.«
Ich sehe mit gerunzelter Stirn zu Robert. Langsam geht Immel mir auf die Nerven. Er schreibt:
Grüß Gott, Paul und Robert,
hier hat sich was ganz Großes ergeben. Steve ist der Neffe von Marcel Weisbrod. Das ist ein wichtiger Kunstzampano, der mir weiterhelfen kann.
Steve fährt mich zu dem Typen nach Hause nach Englitz, etwa eine Stunde mit dem Auto. Das ist wichtig für mich. Holt mich doch dort ab.
Euer bester Freund
Immel
Ich halte Robert das Blatt hin. Der holt hörbar Luft, schaut auf die Uhr und macht eine Was-solls-Geste.
Also gut. Noch eine Etappe. Egal. Natürlich holen wir Immel dort ab.
»Jungs, fahrt da hin«, sagt H. D., »der Weisbrod hat ’ne Menge Einfluss in der Kunstszene, der hat Kontakte zu Galerien in New York, Agenturen, Rundfunk, Fernsehen und alles. Damit aus dem Immel endlich mal was wird. Das geht doch so nicht weiter, oder?«
»Das stimmt«, sage ich. »Okay, wir machen uns auf den Weg. Was ist mit euch?«
»Wir bleiben noch in Dresden. Alles Gute. Hat mich sehr gefreut«, sagt H. D. Wir geben uns die Hand. Asia gibt mir einen Kuss auf die Wange. Robert und sie verabschieden sich ausgiebig und mit Zunge. Sharon redet irgendetwas mit H. D. Sie ist offenbar über sein Beziehungskonzept im Bilde.
Minuten später sitzen Robert und ich wieder im Auto.
»Ich liebe Liebe zu dritt«, trällere ich.
»Oh Mann«, stöhnt Robert, »oh je, oh je.« Er schlägt die Hände vors Gesicht.
»Das lässt sich ja gut an mit deinem Single-Dasein. Ich denke, da hilft nur eins.«
Und ich lege meine Strokes-MD ein.
»Last night she said, oh, baby, I feel so down, oh, it turns me off, when I feel left out«, singe ich mit und fühle mich gut, obwohl wir gerade wieder auf der A 13 nach Norden fahren, also in die Richtung, aus der wir gestern gekommen sind. So kommen wir nie in den Schwarzwald.
Beim zweiten Refrain steigt Robert mit ein. Fünf Songs später, beim Gitarrensolo von Ize of the World, sehe ich, wie Robert versonnen zum Fenster hinaus lächelt. Er hat noch mehr graue Haare bekommen. Wenn er so weiter macht, lässt er die George-Clooney-Phase bald hinter sich und marschiert stramm Richtung Sky Dumont.
Eine Stunde später fahren wir in ein Dorf in der Nähe von Hoyerswerda, das genauso aussieht, wie man sich einen Ort in Ostdeutschland, der seine besten Tage lange hinter sich hat, vorstellt: viele leer stehende Häuser und Geschäfte, halbverfallene Scheunen, kein Mensch auf der Straße zu sehen.
»Aber Hier Leben, Nein Danke!«, skandiere ich den Tocotronic-Song.
Wir können Immel nicht anrufen, da er aus Prinzip kein Handy besitzt. Wir fahren an einer Bushaltestelle vorbei, an der vier Skins um einen Golf stehen und uns feindselig anglotzen. Am Ende der Hauptstraße sehen wir einen schwarzen Ford Taunus. Das muss Steves Wagen sein. Er parkt vor einem riesigen alten Bauernhof, in den jemand in den letzten Jahren eine Menge Geld gesteckt zu haben scheint. Er wirkt reichlich deplatziert. Renoviert. Gestrichen. Gepflegt.
Wir klingeln.
Immel öffnet die Tür.
»Männer! Bin ich froh, euch zu sehen.«
Er führt uns in einen großen Raum, in dem ein älterer Mann mit weißen Haaren, Pferdeschwanz und Pfeife gerade dabei ist, Drinks einzugießen. Er sieht ein wenig aus wie der späte Donald Sutherland. Steve sitzt auf einem Ledersofa, ohne Staubmantel, aber mit Boots und Lederhose und einem Laptop auf dem Schoß. Er winkt uns kurz zu. Weisbrod streckt Robert und mir statt einer Begrüßung Whiskygläser entgegen, nickt uns kurz zu, redet aber die ganze Zeit nur mit Immel.
»Fazit, Immel: Die Sachen sind gut. Die in New York drehen durch, wenn die erfahren, dass du ein Berliner Künstler bist. Ich mache das mit dieser Galerie in Berlin klar, dann Kulturzeit, Aspekte, ART und alles. Hier!«
Er reicht auch Immel ein Glas und wir stoßen an. Weisbrod verschwindet kurz.
Immel, der sich bisher sein bestes Pokerface bewahrt hat, schüttelt mich.
»Fuck, das ist der Wahnsinn. Das könnte es echt sein!«
»Ich dachte, du willst gar keinen Erfolg«, sage ich.
Immel grinst und prostet uns zu.
Weisbrod kommt wieder zurück.
»Also, Immel, wenn du wieder in Berlin bist, ruf mich an. Hier ist meine Karte mit privater Handynummer. Nächste Woche bin ich dort. Dann treffen wir uns.«
Wir schütteln uns die Hand. Immel geht zu Steve und gibt ihm auch die Hand.
»Danke, Mann.«
»Drei Begräbnisse mit Tommy Lee Jones war auch toll«, ruft Steve in meine Richtung.
»Besser als No Country for Old Men«, sage ich altklug und sehe, dass ihn diese Antwort freut.
»Wahoo«, brüllt Immel, als wir im Auto sitzen. »Ich dreh durch. Ich dreh duuurch.«
»Immel, das ist wirklich –« Weiter komme ich nicht, denn als wir die Skins passieren, kurbelt er das Fenster runter und schreit: »Adios, ihr Kackbratzen!«
Im Rückspiegel sehe ich, wie die Skins hektisch in ihren Golf springen.
»Immel, du Verrückter!«, schreie ich. »Hast du einen an der Waffel?«
»Oh«, sagt er.
Ich drücke aufs Gas.
***
- Ende der Leseprobe -