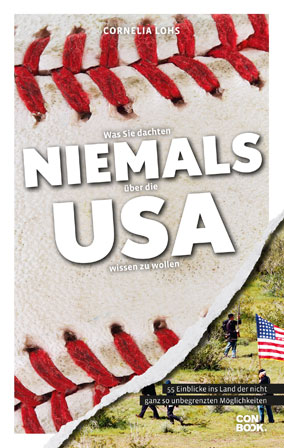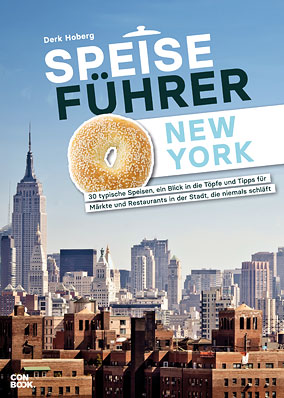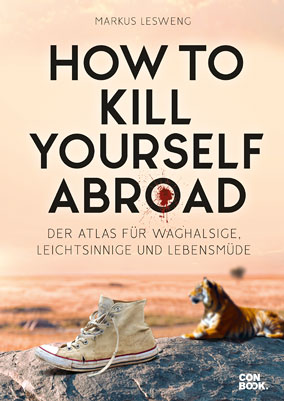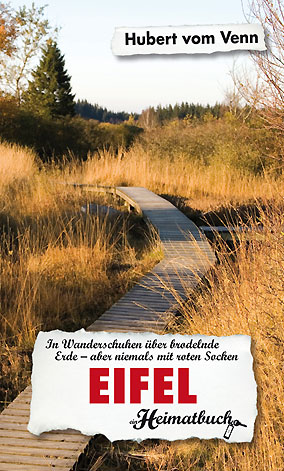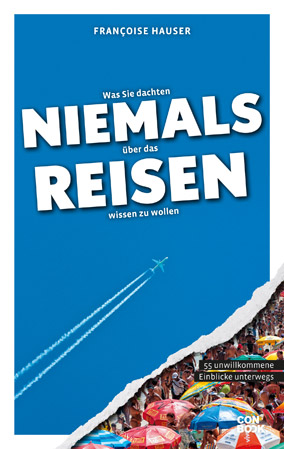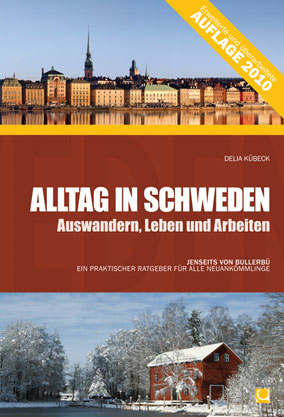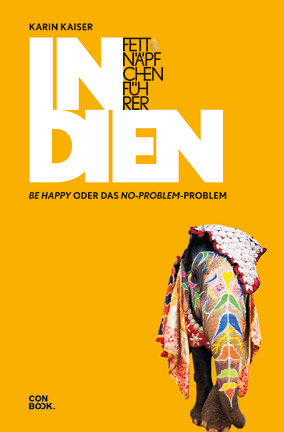Fifty States of Wigge
50 Staaten, 50 Tage, 50 Challenges

Dezember 2016 (3. Auflage)
Taschenbuch mit Einbandklappen, 272 Seiten
ISBN: 978-3-95889-119-7
€ 10,95 [D] • € 11,30 [A] • SFr. 16,50* [CH]
Das Buch zur Challenge im WDR FERNSEHEN: Michael Wigges verrückte Tour durch alle 50 US-Staaten im Superwahljahr 2016
Nachdem er ohne Geld bis ans Ende der Welt gereist ist, sich vom Apfel zum Eigenheim hochgetauscht hat und auf einem Tretroller durch Deutschland gefahren ist, stellt Michael Wigge sich seiner neuen Herausforderung. Innerhalb von 50 Tagen will er alle 50 Staaten der USA durchqueren. Insgesamt 20.000 Kilometer bestreitet er dabei ganz allein in seinem Campervan.
Das wäre ja noch eine halbwegs machbare Aufgabe, würde sich Wigge nicht auf einer ganz besonderen Kulturmission befinden: In 50 schrägen Challenges will er jedem der amerikanischen Bundesstaaten auf den Zahn fühlen und herausfinden, was wirklich typisch für Land und Leute ist. Und das ausgerechnet im Superwahlkampfjahr! Da nimmt Michael Wigge auch bei eingefleischten Hillary-Fans und Donald-Anhängern kein Blatt vor den Mund.
Entdeckt Wigge einen bekennenden Republikaner unter all den Demokraten im Staat Washington? Wird er es in Oregon schaffen, die Stadt Boring an einem Abend in ein Partymekka zu verwandeln? Findet er heraus, warum jeder fünfte Einwohner von South Carolina in einem Trailerpark wohnt? Oder wieso Kansas City eigentlich nicht in Kansas liegt, wo es hingehört? Und wie schafft Wigge es, in den letzten Stunden seiner Reise einen Toast Hawaii in Hawaii aufzutreiben?
US-Kultur im Schnelldurchlauf – geht das? Michael Wigge findet es heraus. Denn wo ein Wigge ist, ist auch ein Weg!
Stimmen zum Buch
»Ich finde Wigge super!«
(Allradler – Das Abenteuer Offroad Magazin)
»Unterhaltsame Lektüre.«
(ekz.bibliotheksservice)
»Wigge schildert skurrile und unbekannte Ecken der USA und vermittelt unterhaltsam das ur-amerikanische Lebensgefühl ›Take it easy!‹.«
(Hannoversche Allgemeine Zeitung)
Leseprobe
Tag 2 – Staat 2: New Hampshire, Littleton – 700 Kilometer
Der Pizzastaat
Ich fahre von Maine nach New Hampshire, denke über Selbstverantwortung nach. Jeder ist für Reaktionen der Gesellschaft selbst verantwortlich. Am Anfang meiner Reise habe auch ich die Selbstverantwortung abgegeben, klagend über die Staus und die Kälte. Ich kann noch so viel klagen, es wird nichts ändern, schließlich liegt es an meiner eigenen Haltung, wie ich mit den Umständen umgehe. Ich habe mir diese Reise ausgesucht, auch, wann ich sie starte und in welchem Land ich sie umsetze, deshalb ist es meine Verantwortung, in welche Situationen ich gerate.
Ich fahre durch wunderschöne Landschaften, durch die White Mountains. Eine tolle Bergkette, schneebedeckt, zwischendrin kleine Orte im Architekturstil Neuenglands. Es ist ein kolonialer Architekturstil des 17. bis 19. Jahrhunderts. Die Häuser sind hauptsächlich aus Holz, oftmals weiß gestrichen mit englischen Einflüssen, wie der Name schon sagt. Die Hauptstraße des Örtchens Littleton wirkt hell und sympathisch durch die weißen Holzhäuser.
Challenge 2: Finde heraus, ob die Einwohner von New Hampshire eine Pizza oder 20 Dollar bevorzugen!
New Hampshire wird von mir als Pizzastaat benannt, da statistisch gesehen hier die höchste Pizzarestaurantdichte ganz Amerikas herrscht. Auf 10.000 Einwohner kommen 3,87 Pizzarestaurants. Durchschnittlich sind es nur etwas über zwei Pizzarestaurants in den USA. Und in Littleton sieht es noch krasser aus. Ich finde insgesamt sieben Pizzerien für ungefähr 5.000 Einwohner. Littleton ist also so etwas wie die heimliche Pizzahauptstadt Amerikas.
Was läuft hier also? Neigt man durch die schöne Natur und Architektur etwa dazu, sich konstant Pizzen reinzuziehen? Oder mangelt es vielleicht an Fleisch und Fisch und man greift einfach immer wieder auf Pizza zurück?
Ich kann es nur durch einen Test herausfinden: In der linken Hand halte ich eine große Pizza und in der rechten einen 20-Dollar-Schein. Wie viele Passanten werden sich für die Pizza und wie viele für das Geld entscheiden?
Bei meinem Streifzug über die Hauptstraße Littletons höre ich verschiedene Reaktionen.
»Hab grad erst zu Mittag gegessen, nehme also das Geld!«
»Geld ist Amerikas Leidenschaft. Sorry, Geld geht immer vor Pizza!«
»Wow, das wird meine zweite Pizza heute, danke!«
Insgesamt teste ich 14 Passanten. Vier nehmen die Pizza, neun die 20 Dollar und eine Person ist unentschieden. Das sieht für mich eher nach der heimlichen Geldhauptstadt Amerikas aus. Was ist also los?
Ich gehe in eine Pizzeria an der Hauptstraße und spreche mit dem Besitzer Dimitris, der mir verspricht, dass auch er jeden Tag ordentlich Pizza isst. Aber er unterstreicht, was ich vorher schon gehört habe: Geld regiert die Welt.
Bei aller Pizzaleidenschaft würde Geld in Amerika immer siegen, erklärt er mir.
»Schließlich befinden wir uns im hundertprozentigen Kapitalismus. Es geht im Endeffekt immer ums Geld, und davon kaufst du dir dann deine Pizza!«
Auf meiner Weiterfahrt denke ich lange über seine Aussage nach, schließlich ist das europäische Wirtschaftsmodell auch kapitalistisch. Aber meine USA-Erfahrungen in den letzten Jahren haben mir immer wieder ein anderes Level des Kapitalismus aufgezeigt. Seitdem ich beruflich auch amerikanische Kunden habe, Amerikaner Teil meines Freundeskreises sind und ebenfalls ich in den USA konsumiere und Dienstleistungen in Anspruch nehme, spüre ich einen deutlichen Unterschied zu Deutschland beim Thema Geld. Wenn ich zum Beispiel in den USA eine Dienstleistung vom Automechaniker, Versicherungsagenten oder vom Vermieter in Anspruch nehme, muss ich viel mehr aufpassen, dass ich nicht plötzlich ein leeres Portemonnaie habe. Letztes Jahr habe ich mein Auto reparieren lassen. Der Mechaniker meinte: »Ja ja, krieg ich hin, kein großes Ding!« Eine Woche später legte er mir eine Rechnung von 4.000 Dollar vor. Ich fiel aus allen Latschen, damit hatte ich nie gerechnet. Ja, der große Fehler war gewesen, dass ich ihm einfach vertraut hatte. Erst nachdem ich mir alle Ersatzteile habe auflisten lassen, die Arbeitsstunden überprüft hatte und meinte, dass ich zuerst von anderen Mechanikern Vergleiche einholen möchte, ging er plötzlich mit dem Preis um 1500 Dollar runter. Nicht dass mir das nicht in Deutschland hätte passieren können, aber die fehlende Regulierung des Marktes und der hohe Konkurrenzdruck scheinen hier dreiste Forderungen einfach möglicher zu machen.
Anderes Beispiel: Mein Auto in den USA ist natürlich versichert. Kurz vor dieser Reise habe ich meine Versicherungsagentin gebeten, eine Personenhaftpflichtversicherung hinzuzufügen, und habe ihr gesagt, dass ich nun länger verreise. Kurz vor der Abfahrt schaute ich in den Briefkasten und sah nicht eine Zusatzversicherung, sondern gleich vier für 500 Dollar extra. Klar, das konnte ein Missverständnis sein. Aber als ich die Agentin mit der Situation konfrontierte, wurde sie nervös, und nach einigem Hin und Her merkte ich, dass sie wohl wirklich gedacht hatte, ich sei schon längst verreist und hätte so ein bisschen mehr Versicherungsschutz nicht bemängeln können.
Also wechselte ich sofort den Versicherungsagenten und war nun für 100 Dollar monatlich versichert. Schon nach kurzer Zeit erhielt ich die erste Rechnung in Höhe von 129 Dollar. Ich war echt schockiert und rief die neue Agentin an. Sie erklärte mir, dass die vereinbarten 100 Dollar eher eine Schätzung gewesen waren, für den besprochenen Versicherungsschutz muss ich nun doch 29 Dollar mehr zahlen. Also erwähnte ich, dass ich dann noch mal den Agenten wechseln würde. Plötzlich gab sie mir ein Sonderangebot für 107 Dollar.
Ende letzten Jahres war ich im Sportgeschäft, um mir neue Sportschuhe zu kaufen. Ich bat direkt um ein gutes Angebot, da ich nicht so viel zahlen wollte. Der Verkäufer reichte mir sofort Laufschuhe für 199 Dollar und erzählte mir, dass das der beste Deal sei und es einfach nicht günstiger gehe. Ich schaute während seines Verkaufsmonologs auf das Schuhregal und sehe Nike-Laufschuhe im Sonderangebot für schlappe 49 Dollar und konnte es kaum fassen, wie ich absichtlich fehlberaten wurde.
Warum das Ganze? In der Regel werden Angestellte in den USA auf Leistung bezahlt. Je höher die Verkaufszahlen, desto höher das Einkommen. Kulturell scheint es darüber hinaus akzeptiert zu sein, aggressive Verkaufsstrategien durchzuziehen. Ich bin mir sicher, dass viele Amerikaner die 29 Dollar extra monatlich bei der Versicherungsgebühr nicht beanstandet hätten. Ich empfinde Amerikaner in dem Punkt oftmals großzügiger, man denkt sich: Egal, ich hab eh so viel um die Ohren.
Viele Geschäfte können in den USA durch die Zahlung mit der Kreditkarte die E-Mail-Adresse des Kunden bekommen. Nach dem Supermarkteinkauf beginnt dann der Spam. Als Europäer mit gemäßigtem Konsumverhalten und der Gewohnheit, dass Verkaufsstrategien nicht zu agressiv sein dürfen, wirkt das befremdlich. Heute gebe ich nur noch meine angeblich neue E-Mail-Adresse raus: Iamsotiredofthis@yahoo.com.
Ich denke, in Deutschland geht man da viel schneller in die Kontroverse, wenn man überrumpelt wird, Zusatzkosten erhält etc., und man besteht einfach auf sein Recht. Da Amerikaner darauf aus Höflichkeit gerne verzichten, haben sicherlich viele Amerikaner höhere laufende Kosten als gewünscht.
Tag 3 – Staat 3: Vermont, Montpelier – 810 Kilometer
Der liberale Bundesstaat
Ich wache auf der Rückbank im Van auf, nach neun Stunden Schlaf. Im Leben hätte ich nicht gedacht, dass ich auf einer Rückbank so tief und fest schlafen kann, aber die Erschöpfung war gestern so groß, dass ich wahrscheinlich auch stehend in einer Menschenmenge neun Stunden geschlafen hätte.
Ich steige aus dem Van und gehe durch Montpelier, der Hauptstadt von Vermont. Montpelier ist in der Aussprache nicht mit dem französischen Montpellier zu verwechseln. Man spricht es aus wie »Montpällieeer«. Und diese Bundesstaatenhauptstadt ist ziemlich besonders:
- Einzige Staatenhauptstadt Amerikas ohne McDonald’s-Restaurant
- Nur 7.500 Einwohner
- Sehr linksliberale Bevölkerungsstruktur (Demokrat Bernie Sanders kommt aus Vermont)
- Vermont ist so eine Art Good State. Hier wurde als Erstes die Sklaverei abgeschafft und heutzutage herrscht hier die niedrigste Kriminalitätsrate der USA.
In den Sechzigern sind viele Hippies in das Städtchen gezogen, sodass man heute viele ältere Herrschaften mit langen Haaren in den örtlichen Cafés sieht.
Challenge 3: Umarme 10 Passanten, finde darunter jemanden, der Donald Trump aufgrund seines Bad-Boy-Images wählen will!
In einem linksliberalen Hippieort ist diese Herausforderung wohl eine Mission Impossible. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Los geht’s!
Ich bitte 10 Passanten mich aufgrund der Challenge zu umarmen, und während der Umarmung frage ich ganz unerwartet: »Do you vote for Donald Trump?«
Viele Passanten erschrecken sich über diese unerwartete Frage und antworten wie folgt:
1. Jessy: »Nee, an den Typen glaub ich nicht.«
2. John: »Ja, ich wähle Trump, aber ich wähle ihn wegen Jobs.«
3. und 4. Mavery und Samantha: »Niemals, nicht in einer Millionen Jahren!«
5. Annie: »Niemals, aber ein Bad Boy kann generell auch sexy sein.«
6. und 7. Tony und Bianca: »Wenn der gewählt wird, ziehen wir nach Kanada.«
8. Claire: geht schweigend weg, als ich die Frage stelle.
9. Peter: »Ich bereue diese Umarmung.«
An diesem Punkt ist mir klar, dass ich die Challenge nicht gewinnen kann. Nur einer von neun Passanten ist Republikaner gewesen und dieser fand das Bad-Boy-Image von Trump auch nicht gut. Was nun?
Ich will unbedingt die Challenge gewinnen und schaue mir genau die Personen auf der Straße an. Für meinen letzten Versuch darf ich niemanden mit langen Haaren wählen, kein alternatives Outfit, am besten jemanden, der etwas kantiger daherkommt, jemand der auch zeigt, dass er gerne mal aneckt.
Da entdecke ich Garry, der gerade vorbeikommt und mich irgendwie frech angrinst. Das ist er! Ich frage ihn, wie er zum Trump-Image steht. In der Frage lege ich ihm eine positive Antwort schon nahe. So nach dem Motto:
»Findest du das Bad-Boy-Image von Trump auch so super?«
Zusätzlich strecke ich ihm ein großes Grinsen entgegen, das auf eine Bestätigung wartet.
Und Garry sagt:
»Ja! Ich mag sein Bad-Boy-Image, so richtig Bad Ass, der Kerl!«
Ich jubele, der zehnte Passant bringt es raus. Garry ist total überrascht, darüber dass die Aussage so viel Freude in mir auslöst. Ich umarme ihn, was ja auch zur Challenge gehört. Jetzt wird Garry etwas misstrauisch.
»Alles gut bei dir?«
Ich bestätige und sage ihm, dass ich nun endlich in den nächsten Staat reisen kann. Garry winkt grinsend ab und kann den Zusammenhang natürlich nicht verstehen.
Zum Abschluss frage ich ihn noch, was so gut am Bad-Boy-Image von Trump ist. Garry erklärt, dass er den Wahlkampf dieses Jahr als große Unterhaltungsshow sieht, und das hat Trump bekanntlich drauf.
***
- Ende der Leseprobe -